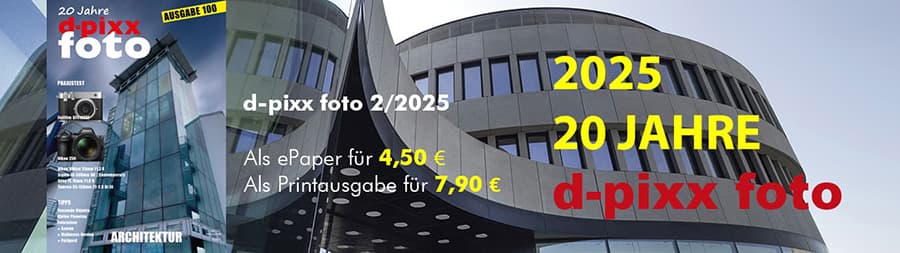...es geht weiter...
 Teil 2 – Anfänge und viel Theorie
Teil 2 – Anfänge und viel Theorie
Wohl fast jeder, der mit der Makrofotografie angefangen hat, tat dies sehr wahrscheinlich mit einem Makroobjektiv. Dies ist in der Regel ein einfacher Weg in die Geheimnisse der kleinen Dinge vorzudringen. Wobei der Begriff „klein“ sicher relativ ist und auch dazu werden wir noch was lesen/sehen.
Makroobjektive gibt es von den Kameraherstellern, wie auch von Fremdherstellern. Meist mit Brennweiten um die 100mm und mit f2.8 auch recht lichtstark. Die Objektive der Fremdhersteller sind in der Regel etwas preiswerter, aber nicht unbedingt schlechter in der optischen Qualität.
Allerdings gibt es hier oft Einschränkungen im Bedienungskomfort. So haben Fremdhersteller tlw. keinen Autofokus (AF). Ob ein AF für die Makrofotografie wichtig ist, werden wir noch genauer betrachten. Ein wichtiger Punkt hierbei ist sicherlich die Nutzung der „Fokus-Bracketing“ Funktion bei einigen Systemkameras (z.B. Olympus). Hierzu muss die Kamera den Fokus steuern können.
Warum fangen viele Fotografen nun mit einem Makroobjektiv an? Wohl auch aus dem Grund, weil es eigentlich ein „normales“ Objektiv ist, welches allerdings optisch für den extremen Nahbereich optimiert wurde.
Ein solches Objektiv ist allerdings auch jederzeit im normalen Betrieb zu verwenden. So kann ein 100mm Makroobjektiv auch z.B. für Portraits herhalten und schafft bei offener Blende meist ein weiches Bokeh.
Aber für Makroaufnahmen eben einfach auf die Kamera gesetzt und schon hat man die Möglichkeit das Motiv im Maßstab 1:1 abzulichten. Ohne weitere, komplizierte Technik hinzunehmen zu müssen. Zu Anfang macht sicher allein die Fotografie in der direkten Nähe zum Objekt, mit dem damit verbunden sehr kleinen Schärfebereich, schon genug Probleme.
Schauen wir uns diese Schärfebereiche doch mal etwas näher an – und ja…leider gibt es jetzt einen Haufen Theorie:
Wir denken mal an ein praktisches Beispiel und wollen ein Insekt in der Natur fotografieren. Der Abstand zum Insekt soll die Naheinstellgrenze des Objektivs sein. Dies ist der minimalste Abstand vom Objekt zur Sensorebene(!) und bringt in der Regel erst den ABM von hier eben 1:1
Ich weiß, dass für viele der genaue ABM (also z.B. 1:1) nicht so wichtig ist.
Da geht es doch mehr um das Motiv harmonisch im Bild zu platzieren. Was auch für mich die Hauptrolle beim Fotografieren spielt und völlig o.k. ist. Zudem vergrößert sich so der Schärfebereich und ich nutze dann gerne auch mal einen Ausschnitt - die modernen Sensoren lassen das ja meist gut zu.
Aber für einen Vergleich muss ich von mindestens einer festen Bezugsgröße ausgehen…daher die „Umrechnung“ auf 1:1.
Noch ein Hinweis: die unterschiedlichen Abbildungsgrößen der Sensoren wurden in die Rechnung einbezogen. Dadurch können wir den Aufnahmeabstand hier gleichhalten (sonst würde sich der Abstand vergrößern- bei gleichem Bildinhalt, oder der Bildinhalt würde sich vergrößert darstellen).
Wir nehmen dazu zunächst ein Makro mit f2.8 und 100mm Brennweite und mit 300mm Naheinstellgrenze. Nun sind wir bei einer Vollformatkamera so nah am Motiv, dass es formatfüllend (also 24x36) aufgenommen werden kann.
Bei unterschiedlichen Blendenöffnungen erhalten wir auch je nach Sensorgröße (Vollformat, APS-C, mft) folgende Schärfezonen:
Blende Vollformat APS-C mft
f2.8 0,34mm (f5,7) 0,42mm (f4,7) 0,46mm (f4,3)
f5.6 0,68mm (f11,3) 0,85mm (f9.4) 0,92mm (f8,7)
f8 0,96mm (f16) 1,2mm (f13,3) 1,8mm (f12,3)
f10 1,21mm (f20,2) 1,7mm (f18,9) 1,84mm (f17,3)
f13 1,61mm (f26,9) 2,2mm (f22,4) 2,19mm (f20,6)
f16 1,92mm (f32) 2,4mm (f26,7) 2,6mm (f24,5)
Wir sehen also, dass der Bereich der scharfen Abbildung bei den kleineren Sensoren größer wird und zudem auch eine kleinere Blende für einen erweiterten Schärfebereich sorgt.
Was sind das für Blendenwerte in den Klammern?

Diese Werte geben die jeweils „effektive“ Blende an.
Bei der Makrofotografie ändert sich die §effektive" oder "wirksame" Blende nach folgender Formel:
Nominelle Blende x (Abbildungsmaßstab + 1)
Wie hier bei einem ABM von 1:1 kann also von einer Verdoppelung der jeweiligen Blende ausgegangen werden. Die in der Tabelle für APS-C und mft geringeren Werte rühren von der Umrechnung auf die Abbildungsgröße von 1:1 her.
Bei den kleineren Sensorformaten würde sich ansonsten ja eine scheinbare Vergrößerung ergeben.
Diese Zusammenhänge in eine Tabelle zu fassen, ist ohne Zusatzinfo nicht so ganz simpel…

Wozu überhaupt die Angabe einer effektiven Blende?

Die „Blende“ ist zunächst nichts anderes, als das Verhältnis von Brennweite zu Eintrittspupille (Durchmesser der Frontlinse) – bei Offenblende wohlgemerkt! Unser 100mm f2.8 Objektiv hat also rechnerisch eine Frontlinse von ca. 35,7mm. Nachgemessen stimmt dieser Wert auch!
Andererseits beträgt die Größe der Eintrittspupille hier bei einer Blende von f11 nur noch gut 9mm!
Und nicht nur die Änderung der Blende ändert die Menge des Lichts, welches auf den Sensor fällt. Bei extremer Naheinstellung ändert sich auch der Abstand der optischen Elemente zum Sensor stark – dadurch fällt durch den längeren Weg auch nochmals weniger Licht auf den Sensor.
Kommen wir nun noch kurz zur „Diffraktion“ oder auch der „Beugungsunschärfe“

Je nach Sensorgröße (und ja…nach Größe, Pixelzahl, Pixelgöße, Pixelpitch…) gibt es Grenzen, ab denen das Bild wieder unschärfer wird.
Dies kommt durch die oberhalb dieser Blenden (also kleinere Öffnungen!) beginnenden Diffraktion. Diffraktion ist hier die Lichtbeugung an der Blendenöffnung. Lichtrahlen werden abgelenkt und erzeugen „Beugungsscheiben“ (unscharfe Bereiche) auf der Sensorebene – diese werden dann auch als Unschärfe im Bild empfunden.
Die Grenze wird dabei auch gerne als . „förderliche Blende“ bezeichnet. Hier sind die Beugungsscheibchen (Zerstreuungskreise) nicht größer als die Unschärfekreise, die durch die Sensorgröße und die Größe und den Abstand der einzelnen Pixel gegeben ist.
Als Faustformel kann gesagt werden, da je keliner der Sensor ist, je kleiner ist auch der Zerstreuungskreis und schon kleinere Beugungsunschärfen wirken sich deutlicher aus.
Für eine Vollformatkamera mit 36Mpx beginnt dieser Bereich bei etwa f9,5
Für eine APS-C mit 25MPx bei rund f8 und
für eine mft mit 16MPx schon bei f6,3
Diese Angaben beziehen sich auf die nominellen Blenden und sind normalerweise erst bei 100% Ansicht zu erkennen. Für die meisten Darstellungen sind sie also nicht direkt relevant und für Ausdrucke von Fotos gelten noch deutlich höhere Werte.
Die Wahl einer kleinen Blende ist natürlich gerade bei Makroaufnahmen verlockend und man kann sicher auch einen guten Kompromiss zwischen möglichst großem Schärfebereich und resultierender Qualität finden. Trotzdem sollte Vorsicht bei zu weit geschlossenen Blenden bei kleineren Sensoren geboten sein.
Auf die Möglichkeiten den Schärfebereich anders deutlich zu erweitern (Stichwort "Stacking") kommen wir später noch zurück.
Ich hoffe, die kleine Lesestunde hat dem ein oder anderen im Verständnis der Grundlagen weiter geholfen und beherbergt nicht zu viele Fehler.

Es werden noch weitere "harte Nüsse" kommen, aber beim nächsten mal schauen wir uns die Wirkung unterschiedlicher Brennweiten an - ich hoffe auch mit Fotos!

…Fortsetzung folgt…