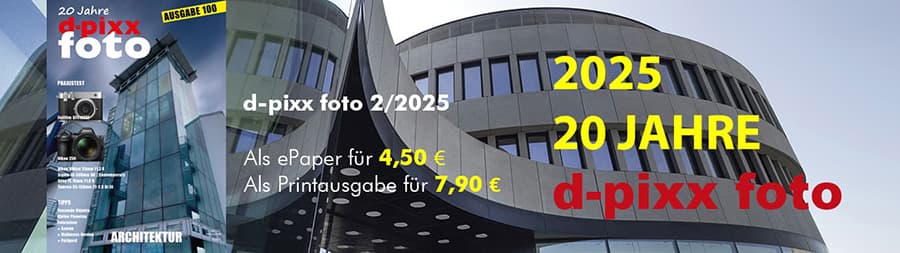3. Etwas Theorie II
Wo wir gerade beim Thema Brennweiten sind…welche Brennweiten eignen sich wofür?
Weitwinklige Objektive, also alles unter 30mm eignen sich für Landschaftsaufnahmen mit Sternenhimmel oder eben Übersichtsaufnahmen größerer Gebiete des nächtlichen Himmels. Mit Ultra-Weitwinkelobjektiven läßt sich (entsprechende Sicht vorausgesetzt) der gesamte, auf der Nordhalbkugel sichtbare Teil der Milchstraße über das Bild spannen! Mittlere Brennweiten – also etwa 50mm bis 85mm können auch schon die etwas deutlicheren Objekte am Himmel (z.B. den die Plejaden oder den Orion-Nebel!) recht gut sichtbar machen.
Die Brennweiten der Objektive entsprechen ja bestimmten Öffnungswinkeln. Da unsere Motive am Himmel auch immer eine spezielle Ausdehnung in Winkelgraden haben, kann man anhand von Tabellen nach geeigneten Motiven Ausschau halten. So kann das Sternbild Orion (etwa 22° in der Hauptachse) mit 50mm schon gut formatfüllend (an APS-C etwa 25° für die Sensorbreite) abgebildet werden. Die Andromeda Galaxie (3°) benötigt schon eher 200mm (6,4°) für ein ansehnliches Ergebnis. Formatfüllend sogar rund 500mm!
Der so gerne und oft fotografierte Mond ist eine Ausnahme: er ist zum einen deutlich heller als alle anderen nächtlichen Himmelsobjekte und benötigt daher meist sehr kurze Verschlusszeiten. Aber er ist leider auch nicht der Größte…man benötigt für eine formatfüllende Abbildung schon eher 1500mm Brennweite! Der Mond hat (wie auch die Sonne) eine Ausdehnung von etwa 0,5° - mit 1000mm kommt man auf etwa 1,3° in der Breite.
Das stabile Stativ hatte ich ja bereits erwähnt – und bitte möglichst nicht die Mittelsäule ausziehen. Wer einmal einen Stern mit einer mittleren Brennweite mittels Live-View anvisiert hat und auch nur sanft an das Stativ getippt hat, wird wissen, was ich meine! Der Stern tanzt auf dem Bildschirm als gäbe es ein Erdbeben…zudem machen sich Windböen dabei deutlich bemerkbar! Unschärfen sind dann kaum zu vermeiden!
Apropos anvisieren…wie stelle ich denn nachts scharf?
Naja…manuell halt! Der Autofokus findet (außer beim Mond vielleicht) kein Ziel und zu wenig eindeutige Kontrastkanten. Bei Weitwinkel-aufnahmen ist das nicht so das Problem – anders bei Aufnahmen mit Telebrennweiten. Hier ist die Live-View-Möglichkeit meist eine gute Methode. Bei maximaler Vergrößerung stellt man das helle Scheibchen eines "Leitsterns" auf den kleinsten möglichen Durchmesser. Beim Live-View stellt man auch immer die Schärfe quasi direkt auf dem Sensor ein.
Also AF an der Kamera AUS! Sollte sich der Bildstabilisator nicht schon automatisch bei der Verwendung von Live-View abschalten, auch den besser abschalten. Meine Pentax hat glücklicherweise eine „Nachtsicht“-Funktion bei Live-View…der Bildschirm leuchtet dann in augenfreundlichem Rot. Ansonsten besser den Live-View nur für die Scharfstellung nutzen und dann abschalten – er blendet sonst ggf. zu stark und man verliert dei Nachtsichtfähigkeit der Augen. Dann auch ggf. die Spiegelvorauslösung (so man denn einen hat) einschalten.
Zur Scharfstellung gibt es noch weitere Hilfsmittel/Methoden mit speziellen Schlitzmasken (Stichwort „Scheinern“) vor dem Objektiv. Hierbei wird eine Schlitzmaske vor dem Objektiv positioniert - die generiert zwei Bilder des Sterns, die dann bei ausreichender Schärfe zu einem verschwimmen. Allerdings wird es dann auch auf dem Live-View Bildschirm recht duster, weil die Schlitzmaske doch recht viel Licht schluckt. Die Maske muss bei der Belichtung natürlich wieder abgenommen werden.
Wo wir schon bei der Kamera sind: die ISO-Zahl ruhig hochdrehen (außer beim Mond!) – je kürzer fällt die Belichtungszeit aus! Bei heutigen Modellen kann man getrost 3200 oder auch 6400 ISO ohne viel Rauschen erwarten. Je mehr Licht gesammelt wird, je mehr Details werden später sichtbar! Bitte NICHT! auf die ggf. erscheinende, partielle Überbelichtungswarnung der Kamera achten - das war auch schon mein Fehler.
Ich habe darufhin die ISO reduziert - mit dem Ergebnis, dass nach der "Entwicklung" einfach weniger Details erkennbar waren.
Natürlich fotografieren wir im RAW-Modus und bei längeren Belichtungszeiten schalten wir ggf. auf den „BULB“-Modus.
Auslösen der Kamera erfolgt dann am besten auch gleich per Fernauslöser (IR, Funk oder einfach Kabel) – so vermeidet man jede Erschütterung...der Spiegel ist bei Live-View ja bereits oben. Nutzer einer spiegellosen Systemkamera haben da eine Sorge weniger.
Was ist noch wichtig? Da wir diese Art der Fotografie in der Regel nachts und draußen bewerkstelligen wollen und auch Technik bedienen müssen: vielleicht eine Stirnlampe – die sinnvollerweise auch noch auf rotes Licht umschaltbar ist. So verlieren wir nicht die Nachtsichtfähigkeit unserer Augen (die erst nach 15-20Minuten in der Dunkelheit vollständig zur Verfügung steht). Bei kühlem Wetter natürlich warme Kleidung, ggf. eine Thermoskanne mit heißem Kaffee oder Tee?
Und ganz wichtig: den Standort so auswählen, dass man auch eine gute, freie Sicht auf die zu fotografierenden Objekte am Himmel hat. Dazu der Hinweis, dass Objekte in der Nähe des Horizonts eher problematisch sind. Das kommt durch das mehr an Luftmassen und die dadurch oft erhöhten Luftturbulenzen (gerade nach heißen Sommertagen!) und zum anderen durch die schlechtere Sichtbarkeit.
Selbst bei einem klaren, wolkenlosen Himmel und möglichst wenig Licht in der Umgebung(was wir ja voraussetzen!) gibt es nämlich noch ein Problem: Die sogenannte „Lichtverschmutzung“ nimmt leider immer mehr zu und lässt den Himmel (vornehmlich eben bei flacheren Winkeln) in einem gelblichen (Vom Lichtspektrum der meisten Straßenlampen) Farbton erstrahlen. Am Nachthimmel in mancher Großstadt sind dadurch oft nur noch wenige Sterne zu entdecken.
Die Qualität eines nächtlichen Himmels ist in der sogenannten „Bortle“-Skala in Stufen eingeteilt: Stufe 1 ist die beste Sicht bei vollständig dunklem Himmel, Stufe 9 ist die schlechteste…ein heller Großstadthimmel. Kleinere Städte oder Vororte liegen meist mit einer 4-5 im mittleren Bereich.
Bei etwa Stufe 5 liegt auch mein kleiner Heimatort...ich werde also bald wohl mal eine kleine Reise in die dunkleren Lande unternehmen.
Astrofotografie ist prinzipiell überall möglich – nur der (Zeit-)Aufwand wächst mit zunehmender Lichtverschmutzung. Man muss einfach länger belichten, um Details deutlich heraus zu arbeiten!
Auf alle Fälle sollte man seine Vorhaben nicht gerade auch noch in eine helle Vollmondnacht planen (außer natürlich, der Mond ist das Ziel der Begierde!). Die Zeit kurz vor bis kurz nach Neumond sind ideal – und der Mond ist ja auch nicht jede Nacht am Himmel zu sehen. Hier helfen auch wieder Tabellen aus dem Internet, in denen die Mondauf und -untergangszeiten je nach Datum vermerkt sind.
Gegen die Lichtverschmutzung gibt es (abgesehen vom Ausweichen in dunklere, ländlichere Regionen) übrigens sogenannte „Clear-Sky“ oder „Nachtsicht“ –Filter, die einen bestimmten Anteil der störenden Wellenlängen des Umgebungslichtes herausfiltern – allerdings sind diese Filter -je nach Größe- auch recht teuer.
So…das soll es mit der Theorie für den Einstieg auch schon gewesen sein – ich habe sicherlich viel vergessen, aber für einen gelungenen Einstieg in diese Art der Fotografie sollte es reichen.
Das nächste Kapitel kommt dann endlich zur Sache und widmet sich mehr der Praxis. Ich habe ja schon einige Fotos eingestellt…weitere Aufnahmen sind natürlich wetterabhängig! Nur bei völlig klarem Himmel lohnt sich diese Art der Fotografie. Ich werde ein wenig von meinen persönlichen Erlebnissen -positiv und negativ- berichten.
Danach kümmern wir uns auch noch um die Nachbearbeitung und die dafür notwendige Software!
Gerade bei Astrofotos ist das essentiell wichtig! Manche Motive bleiben sonst fast unsichtbar…
Also drückt die Daumen, dass es bald wieder klare Nächte gibt!